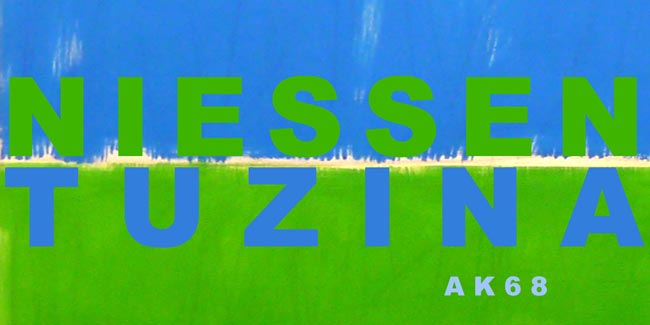
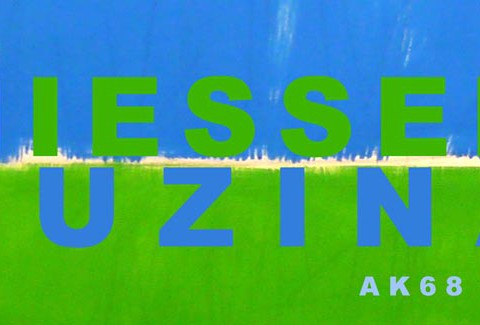
Günter Tuzina, Jochen Niessen | Parallele Welten
Stefan Scherer | Kunst und Texte | Tuzina, Niessen – Parallele Welten | 03.05.2014 – AK68 Galerie im Ganserhaus
Bevor ich beginne Ihnen unser diesjähriges „highlight“ nahezubringen, möchte ich Ihnen gerne meinen ersten Eindruck, bzw. meine erste Begegnung mit Jochen Niessen und Günter Tuzina schildern. Und „highlight“ deswegen – und ohne das schmälern zu wollen, was dieses Jahr noch an extrem unterhaltsamen Ausstellungen auf sie zukommt – , weil es uns gelungen ist mit Günter Tuzina und Jochen Niessen hochqualifizierte Malerei und echte Malerprominenz für den AK68 und seine Galerie im Ganserhaus zu gewinnen.
Wie hatten uns natürlich Wochen vorher schon gesehen, aber nur kurz und uns für Anfang letzter Woche zum Hängen im Ganserhaus verabredet. Als ich die Galerie betrat hörte ich schon den Staubsauger und alles erschien mir so sauber, wie frisch gestrichen. Die leere Wand zwischen den schon hängenden Bildern schien mir weißer als üblich und ich hatte die Empfindung einer hyper-ästhetischen Ordnung, also eigentlich die Wahrnehmung von Schönheit ohne mich dabei aber auf ein einzelnes Bild einzulassen.
Also folgte ich dem Geräusch des Staubsaugers weiter bis in den 1. Stock mit dem Jochen Niessen gerade unsere wüste Auslegeware reinigte, die übrigens, – so unsere Sponsoren wollen -, dieses Jahr nicht mehr überleben soll. Ich wand ein, dass am Freitag geputzt würde kam aber schnell dahinter, dass es Jochen Niessen und Günter Tuzina extrem wichtig ist, ihre Bilder zwischen saubere, bzw. klar definierte Flächen zu platzieren. Das ging soweit, dass Günter Tuzina sogar irreversible Brandflecke auf unserem Teppich übermalte. Man kann das verrückt finden. Ich teile aber diese Oberflächensensibilität ganz und gar und warf mir nachher vor, dass ich das schon längst selbst hätte machen sollen.
Eine ähnliche Geschichte über Tuzina fand ich im Katalog des „Gemendemuseums den Haag“ aus dem Jahre 2002 in dessen Vorwort der Kurator Wim van Krimpen seine erste Begegnung mit Tuzina schildert, der ihn 20 Jahre zuvor in Amsterdam besuchte um ihm seine Mappe zu zeigen.
Nach stundenlangen Gebrächen über die Krise der Malerei, der Zeichnung, und der Linie an sich und wohl auch anständigen Getränken beschreibt van Krimpen das Treffen weiter:
„Im Laufe der Nacht wurde die Mappe auf dem Boden der Galerie geöffnet und dies mit einer derartigen Sorgfalt und Präzision, dass es unserem Alkoholkonsum spottete.“ Van Krimpen war von Tuzinas unerschütterlicher Akribie so beeindruckt, dass er über das, was sich ihm dort eröffnete begeistert weiterschreibt: „Das ist die Welt als Suche, treffsicher und unbestechlich forschend, gefärbt in tiefer Schönheit, nie beliebig und nie zuvor gesehen.“
Und bei mir ist es heute Abend die Suche in Günter Tuzinas und Jochen Niessens Werk, d. h. ihre und meine, ihr Forschen nach einem latent sich fortsetzendem Vokabular ihrer Bildsprache und meine nach einer Sprache, die dem gerecht wird, was ihre Bilder uns da liefern, das emotionale Ereignis, seine Beschreibung und Begründung.
Ihrer Präzisionsästhetik, diesem Sinn für eine, die Wahrnehmung adelnde Ordnung bin ich, wie schon erwähnt gleich zu Anfang des Ausstellungsaufbaus begegnet. Tuzina und Niessen haben mir dann Hängung und Beleuchtung gleich völlig aus der Hand genommen und so kam ich zu einer liebenswürdigen Lehrstunde in Hängen und Leuchten samt kölschen Frotzeleien.
Im Ergebnis kann ich mich nicht erinnern unser Galerie im räumlich erleben je so klar, geordnet und sauber empfunden zu haben. Und ich ahne, dass es das Zusammenspiel der Bilder und Räume sein muss, der farbigen Flächen auf dem weißen Grund der Wände, welche dieses banale Wandweiß in solch eine Schönheit erhebt oder sollte ich sagen Wahrheit. Denn der schon in der Moderne angefochtene Begriff „Schönheit“ ist seit dem Paradigmenwechsel der Postmoderne in den 60er Jahren eigentlich völlig obsolet, wie auch das Tafelbild, die Malerei, ja Kunst überhaupt in Frage gestellt wurde.
„Selbstnegation und Selbstreflexion prägten die Kunst der sechziger Jahre. Das reichte hinein bis in die Kunst der siebziger Jahre, wobei neben radikaler Institutionskritik die immanente Selbstbefragung der Kunst tritt. Und die vollzog sich nicht zuletzt als experimentelle Überprüfung der Malerei mit den Mitteln der Malerei.“
Den letzten Satz hab ich mir aus dem Katalog zur Ausstellung Tuzinas im Lehnbachhaus 93 ausgeliehen. Ich finde dieses Zitat deswegen so erwähnenswert, weil es Tuzinas Hintergrund beleuchtet und damit in gewisser Weise auch Niessens und mir gleichzeitig half ein paar Rätsel zu bewältigen. Dazu gehört u.a. Tuzinas Ausspruch beim gemeinsamen Mittagessen auf der Innterrasse. „Er mache keine Kunst, er mache Malerei “ …und ich war froh, dass ich schon beim Cappuccino war.
Natürlich ist diese Haltung, diese Differenzierung den Entwicklungen der siebziger geschuldet, denen Tuzina zunächst seine radikal schlichten Linien in Wandmalereien und Papierarbeiten entgegensetzte. Die Erweiterung des Kunstbegriffs durch Beuys, die sich verstärkt durchsetzende Fotografie und das Aufkommen der Videokunst bescherten dem Begriff Kunst etwas inflationäres, entgrenztes und der Malerei den Verdacht des Naiven und Anachronistischen. Tuzina reagierte darauf zunächst minimalistisch.
„Künstler wie Karl Andre, Dan Flavin, Sol Le Witt waren inzwischen zur geometrischen Abstraktion zurückgekehrt und radikalisierten sie auf Linien, vereinfachte Körper, flach aufgetragene Grundfarben, gerade Linien, rechte Winkel, keine oder nur schwache Farben und platzierten sie sozusagen als physikalische Tatsache in den Bildraum. Diese Tatsachen sollten sich jeder Interpretation entziehen, aber so direkt erfahrbar sein, wie nur möglich. Das künstlerische Vokabular, schon stark reduziert durch Mondrian und den konkreten Künstlern, wie Barnett Newman oder Ad Reinhard wurde nun gänzlich auf sein Alphabet heruntergebrochen zu einer Art Nullpunkt. Und dieser Nullpunkt war es, an dem Tuzina begann.“
Die Beschreibung dieses Nullpunktes hab ich von Franz W. Kaiser, Ausstellungsdirektor des Den Haager Gemeentmuseums und Tuzinas „Cheftheoretiker“, wie mir Tuzina schmunzelnd erklärte. Ausgehend von diesem „Nullpunkt“ entwickelte Tuzina im Laufe der Jahrzehnte seine Linien, Wand und Papierzeichnungen über die rein für sich stehende Linie hinaus zu einem Instrument seiner Malerei, die nun auch als Umriss gelesen werden kann. Diese umrissene Fläche ist nun, wenn auch nicht durchgängig für die Gesamterscheinung seiner Malereien bestimmend.
Seine Auffassung von Zeichnung selbst erklärte mir Tuzina mit dem Begriff des „Disegno“.
Tuzina liebt Kunstgeschichte, bezieht sich darauf und sieht seine Arbeit ganz und gar darin eingebettet.
„Das Disegno ist ein zentraler Begriff der Kunsttheorie der Renaissance in Italien, der es erlaubte, die bildenden Künste von den Handwerken abzuheben. Er entwickelte sich zwischen Anfang des 15. bis Ende des 16. Jahrhunderts zu einer eigenständigen Kategorie. Man verstand darunter eine Form gewordene Idee, die durch Imagination durch eine lineare Zeichnung zu Papier gebracht wurde.“ Michel Angelo sagte in den „römischen Gesprächen“ dazu: „Das Disegno, das man mit anderen Worten auch Entwerfen nennt, ist Quelle und Inbegriff der Malerei, der Bildhauerei, der Architektur und jeder anderen Art des Malens. Es ist die Grundlage jeder Wissenschaft. Wer diese große Kunst beherrscht, der möge erkennen, dass ihm eine unvergleichliche Macht untertan ist. Er wird, mit nicht mehr als Feder und Pergament Dinge schaffen, die größer sind als alle Türme der Welt.“ Maßgeblich unter dem Einfluss des Disegno gründete man 1563 in Florenz die Accademia delle Arti del Disegno, welche bis heute fortbesteht. Interessant finde ich dabei, dass Günter Tuzina im Jahr 1981 mit dem Villa-Romana-Preis in Florenz ausgezeichnet wurde, wo er sich dann ein Jahr aufhielt.
Im Geiste dieses Disegno zog er zarte Bleistift- und Tuschelinien über Blatt und Wand und was damals zwischen den einzelnen Geraden und zwischen Linie und Fläche stattfand kann der Künstler heute auf sämtliche Bildkriterien ausdehnen. Inzwischen hat Tuzina das von geraden und diagonalen Linien durchschnittene Rechteck zu einer Art Modul qualifiziert, welches uns als Zeichungsdiagramm auf weißem oder schwarzem Grund, als Öl- oder Acrylbild auf Leinwand, als Wandbild oder Papierarbeit wiederbegegnet.
In einem Bericht des Kunstforum über seine Ausstellung in der Kunsthalle Zürich 1990 fand ich folgenden Absatz, insbesondere über seinen Umgang mit Farbe; – für mich ist dieser Artikel auch deswegen so interessant, weil Jochen Niessen dort zum ersten mal Günter Tuzina assistierte und wenn man so will dieses Gemeinschaftserlebnis die Initialzündung war für ihre spätere, künstlerische Zusammenarbeit und eben für das, was wir heute hier im Ganserhaus zu sehen bekommen.
„Für Günter Tuzina ist, so ließe sich sagen, das Gemälde ein Haus für Farben. Dessen erste Bedingung wäre das gewählte Format – in der Regel ein Hochformat -, zweite Grundvoraus-setzung das zeichnerische Maßwerk. Hier wird freilich nicht mehr der alte Konflikt zwischen Linie und Farbe ausgetragen, vielmehr geht es um ein Miteinander von Farbfeld und Zeichnung. Die Farben wachsen innerhalb dieser Verhältnisse aufeinander zu, sie finden ihren Ort, ihre Erscheinungsweise verändert sich im Malprozeß.
Tuzina erstellt seine Arbeiten in einer viel Zeit erfordernden Schichtenmalerei. Das Ergebnis ist eine Farb-intensität, wie man sie selten bei einem zeitgenössischen Maler findet. Die Farbintensität ist aber eher ein sekundärer Reflex, ein Ergebnis des Zueinanderfindens der Farben. Sie werden übermalt und so einander angenähert bzw. gegeneinander abgewogen, bis sie in einer schwer zu benennenden chromatischen Nähe liegen, in der Grün so etwas wie der Hauptton ist, Rot als Komplementärfarbe in einem eingedunkelten Kontrast auftritt, wo aber auch Schwarz, Blau, Grau etc. möglich sind.
Der Entstehungsprozeß kann bis zu einem gewissen Punkt eingesehen werden. Die „Kästchen“ werden nicht ausgemalt, an einigen Stellen sind tieferliegende Schichten sichtbar. Tuzina will auch hier Prozesse einsehbar machen, als höchst subtilen Diskurs über die Möglichkeiten des Bildes innerhalb bestimmter Prämissen.“
Alles zusammen genommen und durch die Jahrzehnte hinterlässt Günter Tuzina hier eine breite Spur. Und auf eben auf dieser Spur wandelt Jochen Niessen, – spätestens seit der Zeit ihrer Zusammenarbeit in der Zürcher Kunsthalle, setzt seine eigene Markierungen, ist darin unverkennbar abwegig, um schließlich mit einer parallel verlaufenden Bilderwelt neben Tuzina einzuschwingen. Der Kulturredakteur Bernd Skupin schreibt über Jochen Niessen; und achten Sie mal auf die Parallelen, obwohl sich Skupin bestimmt nicht, – so wie ich – an Franz W. Kaiser oder Vim van Krimpen bedient hat.
„Er dreht die geläufigen Produktionsweisen von Gemälden souverän um. Statt über eine Vorzeichnung die Farben zu setzen, zeichnet er auf die gemalten Flächen, bedeckt Partien des Bildes in einer Art Nachzeichnung mit durchscheinenden oder dichten Lagen von Graphit oder Signierkreide. Dabei ist bereits die malerische Grundlage sehr komplex: Auf eine erste, noch traditionell gemalte Schicht, meist Ölfarbe, trägt Niessen über die ganze Fläche oder partiell eine zweite Schicht aus Druckfarbe auf. Die Reaktion der beiden Farben aufeinander, abhängig von ihrer Dichte, ihrer chemischen Beschaffenheit und dem Trocknungsgrad, bestimmt die Basis, auf die er dann die Zeichnung setzt. Selbst durch diese letzte Schicht bleiben aber Struktur und Auftrag der darunter liegenden Arbeit erkennbar. Niessen macht also die materiellen Dimensionen seiner Werke und den gesamten Arbeitsprozess vollkommen transparent.Diese Sichtbarkeit des gesamten Entstehungsprozesses, die jegliche Korrektur praktisch ausschließt, stellt extreme Anforderungen an die Konzentration des Künstlers, besonders wenn er, wie Jochen Niessen, kein vorab festgelegtes mechanisches Konzept des Bildaufbaus verfolgt, sondern sich von Bild zu Bild vorwärts bewegt, sich von Erfahrungen aus seinen vorhergehenden Gemälden leiten lässt, diese aber auch in immer neuen Versuchen erweitert, verifiziert oder wieder verwirft. Wie bedachtsam Niessen dabei vorgeht, wird in der Komposition seiner Gemälde deutlich. Zwar überlagern sich die einzelnen Schichten in präzisen geometrischen Flächen. Doch diese wirken niemals starr und werden nie nach einem vorab festgelegten Muster platziert. Niessen beobachtet seine Bilder in jedem Stadium genau und lässt sich von ihren Zwischenzuständen und ihren Botschaften bei jedem weiteren Arbeitsschritt leiten. Das Ergebnis sind Blätter und Leinwände von einer großen Ruhe und Ausgewogenheit, die mit einem mechanisch angewendeten geometrischen System nie zu erreichen wäre.
Natürlich spielt in Niessens Arbeit die Geste eine wichtige Rolle – aber eben nicht als direkter und unreflektierter Ausdruck von Emotion und Impuls, wie in „wilder“ Malerei, sondern als jene Bewegung, die das Bild entstehen lässt, die offensichtliche Konsequenzen auf Papier und Leinwand zeitigt und deswegen ständig neu nach eben diesen Konsequenzen befragt werden muss. Dabei können diese Gesten höchst unterschiedlich ausfallen – vom ersten, vielleicht großflächigen und großzügigen Auftrag der Farbe bis zum feinsten meditativen Stricheln der Graphit- und Kreideflächen. Jochen Niessen betont, dass er gerade letztere Tätigkeit nicht unterbrechen darf. Jede Störung des einmal gewählten Rhythmus wäre auf dem Bild sofort zu erkennen, selbst wenn er sich noch so sehr bemühen würde, im gleichen Tempo und mit gleichem Druck zu arbeiten wie zuvor. In Jochen Niessens Gemälden sind folglich nicht nur die gesamte Tiefe und Schichtung ihres Materials und die komplette, lebendige Geschichte ihrer Entstehung präsent, sondern in jedem von ihnen ist auch noch das Echo der Arbeit an früheren Bildern spürbar. Insofern ist jedes seiner Werke weitaus eindeutiger Teil eines kontinuierlichen Prozesses als bei anderen Künstlern. Und so ist es auch nur konsequent, dass Niessen sich weigert, das Graphit zu fixieren, weil sich das locker und organisch aufliegende Pulver sonst in eine starre und tote Masse verwandeln würde. Damit steht letztlich auch der Betrachter keinem versiegelten, abgeschlossenen und entrückten Produkt gegenüber, sondern erlebt einen vorläufigen Zustand eines zumindest potenziell noch veränderlichen Objekts“,…so Skupin.
Besonders diese „Vorläufigkeit“ des Zustandes, die Tatsache des potenziell noch veränderliche Objekts oder Bildes empfinde ich als große Gemeinsamkeit im Schaffen der beiden Künstler, als eine gemeinsame künstlerische Haltung, denn wenn alles offen ist, ist der Weg frei in immer Neues und Ungesehenes im großen Abenteuer Malerei.
Und eben dieser Offenheit haben wir es zu verdanken, dass wir hier insgesamt 12 extra für diese Ausstellung in der Galerie im Ganserhaus geschaffene Gemeinschaftswerke zeigen können, was für mich persönlich ein großer Moment ist. Denn seit wir uns vor gut einem Jahr entschieden hatten Günter Tuzina und Jochen Niessen zu uns einzuladen bereiten sie, – wie ich heute weiß – diese Ausstellung mit derselben Sorgfalt vor und der ihnen so eigenen Akribie, als ging’s nach Amsterdam, Zürich, Madrid, Turin, Wien, Berlin oder zu David Nolan nach New York, alles Orte an denen Tuzina üblicherweise ausstellt.
Die allererste dieser Gemeinschaftsarbeiten, quasi der initiale Prototyp ihres gemeinsamen Schaffens finden sie im Grossen Fensterraum im 1.Stock. Es heißt „kukukaka“ und ist inspiriert durch die Lautmalereien eines Reggae-Songs.
Wenn sie nun dieses Bild ein wenig analysieren wollen, begegnen Ihnen alle Kriterien oder Charakteristika, die das jeweils persönliche Schaffen der beiden Künstler auszeichnet und unterscheidet. Oben, auf der rechten Seite ist es dieses Stück unbehandelter Leinwand, das bei beiden Künstlern ein immer wiederkehrendes Element ist und für mich immer auch ein Allegorie für den Beginn, den Anfang aber auch das Ende darstellt. Dann folgt rechts davon, noch auf diesem Stück roher Leinwand ein vertikaler Streifen Gelb, der wie umgeklappt jetzt rechts davon als gleich großer Graphitsreifen auf der schwarzen Grundierung liegt. Unter-halb und in derselben Breite liegt ein kaum sichtbarer, hellerer Streifen schwarzer Grundierung, welcher zusammen mit dem roh belassenen Leinwandteil nun ungefähr ein Drittel des Bildes ausmacht. Das ist Niessens Teil.
Auf der rechten Hälfte malt und zeichnet und Tuzina auf dem verbleibenden, schwarzen Malgrund das ihn so kennzeichnende asymmetrische Rechteck in einem ebenso bezeichnenden Grün und darauf ein Dunkelblau in einem kleineren, diesmal symmetrischen Rechteck. Beide farbigen Rechtecke sind noch mal mit einer dicken Graphitlinie gefasst und ich hab dann doch vergessen zu fragen, von wem denn diese für beide Künstler stehende Linie ist. Vielleicht auch, weil es mir am Ende dann nicht mehr so wichtig schien, schließlich betrachte ich diese Bild dann doch als eine Einheit, als etwas Gesamtes nicht als das Produkt seiner Teile.
Und darin liegt die Kunst, die Fähigkeit und die satte Malererfahrung, in diesen Gemeinschaftsarbeiten, trotz unterschiedlicher Persönlichkeiten, Stimmungen, Tagesformen und Herangehensweisen Geschlossenheit herzustellen, Offenheit zu erhalten, Beiläufigkeit und Leichtigkeit ohne beliebig zu werden, als wäre es gerade erst gemalt.
Deshalb ist für mich persönlich diese Ausstellung ein richtiges Lehrstück über das, was Malerei kann und ist: – erst einmal als reine Oberfläche aus Rechts, Links, Oben, Unten, Klein und Groß, pastosem oder glatten, stumpfen oder glänzendem Farbauftrag und auch Niessens gezeichneten Graphitflächen als meditativer Akt sowie Tuzinas horizontalen Linien – und mit Verweis auf die Renaissance – als Symbole für das Geistige, die Vertikalen für das Physische, die Diagonale aufwärts, als Weg zur Wahrheit und abwärts geradewegs zur Hölle oder – ein bisschen säkularer – in den Irrtum.
Und nicht zu vergessen, die feinen Schwingungen zwischen den Bildern, das wie ich es nenne „assoziative Vaccum“, diese wunderbare weiße Wand auf die ich halbbewusst projiziere was noch kommen könnte und somit dieses Werk als ein „Work in Progress“ begreife, ein unendliches Band sich fortsetzender Malerei.
Dass darüber hinaus der AK68 durch die Einladung Günter Tuzinas und Jochen Niessens ein Teil diese Bandes, dieser sich weiterzeichnenden Linie mitinitiieren durfte, gibt mir ganz persönlich ein sehr erhabenes Gefühl. Und so halte ich es auch für angemessen Günter Tuzinas und Jochen Niessens Ausstellung der „Parallelen Welten“ hier im Ganserhaus als historisch Ereignis zu sehen und diese Vernissage als historischen Moment und nicht zuletzt – als wär’s in Casablanca – für den Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Stefan Scherer | 03.05.2014
Comments are Disabled